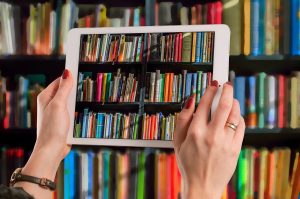
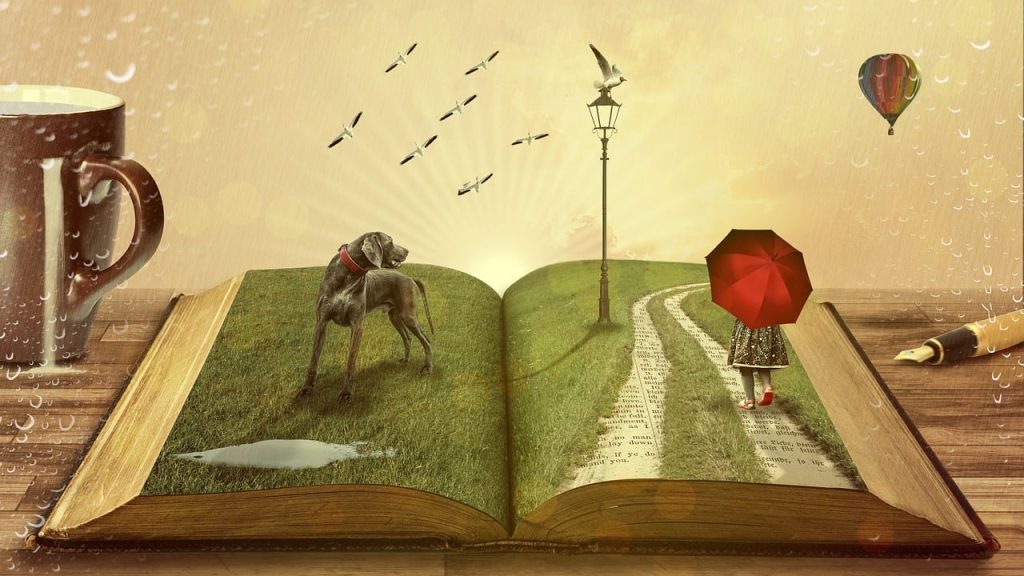
„Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt.“
L. Wittgenstein
Unsere Sprache bedeutet mehr als nur Lesen und Schreiben. Sie befähigt uns zur Kommunikation mit unseren Mitmenschen und uns selbst und ermöglicht uns die Bewältigung von Konflikten. Durch die Auseinandersetzung mit Sprache und Texten lernen wir unsere gesamten Lebenswelt aus verschiedenen Perspektiven kennen. Moderner Deutschunterricht beinhaltet aber auch die Auseinandersetzung mit digitalen Medien.
Kurzinfo: Deutsch am Adolfinum
Wir behandeln im Deutschunterricht spannende und vielfältige Themenbereiche, z.B. lernst du sowohl Klassiker als auch moderne Jugendliteratur kennen, schaust, wie Buchvorlagen in Filmen umgesetzt werden und drehst selbst kurze Videos, z.B. zu Theaterstücken. Auch das Erstellen von Lernvideos mit dem iPad gehört zum Deutschunterricht. Du lernst, wie du Briefe und Mails angemessen verfasst und was alles zu einer aussagekräftigen Bewerbung gehört – Bewerbungsgespräch inklusive! Außerdem üben wir, wie du deinen Standpunkt vertreten und sachlich angemessen diskutieren kannst. Neben diesen thematischen Schwerpunkten kommt auch das Training für Rechtschreibung und Grammatik sowie sprachlichen Ausdruck nicht zu kurz.
In der Oberstufe reisen wir durch die literarischen Epochen der deutschen Literatur, beginnend mit der Literatur um 1800 über den Epochenumbruch um 1900 und die Nachkriegsliteratur bis hin zur modernen Gegenwartsliteratur. Dabei untersuchst du, was die Menschen in anderen Zeiten geschrieben, gedacht und gefühlt haben. Zum Schluss betrachten wir die spannende Entwicklung unserer Gegenwartssprache – wie prägen WhatsApp, Jugendsprachstile, das Internet und Anglizismen unsere Sprache und verändern damit unsere Lebenswelt?
Deutsch im Detail
Fragen an das Unterrichtsfach aus Schülersicht
Deutsch in der Sekundarstufe I
„Das war schon toll, wie der Tell seinem Sohn den Apfel von der Birne geschossen hat, ohne vorher zu proben, alles live. Das hätte ja auch ins Auge gehen können.“
Solche oder ähnliche Stilblüten kommen im Deutschunterricht immer mal wieder vor, gelernt wird aber, sie zu vermeiden.
In den Jahrgängen 5-10 wird hauptsächlich das sichere, zügige Schreiben bei trotzdem gut lesbarer Schrift geübt. Dazu gibt es in der Klasse 5 eine zusätzliche Rechtschreibstunde, in der Lücken aus der Grundschule geschlossen werden. Wer dazu länger braucht, kann in den Jahrgängen 6 und 7 in den Förderunterricht gehen.
Sinnentnehmendes Lesen ist die Grundlage, um in vielen Fächern Inhalte zu erschließen und mit ihnen weiter zu arbeiten. In den Klassen 5-8 wird meist je ein Jugendbuch gemeinsam behandelt, in den Jahrgängen 9 und 10 kommen Interpretationen einfacher Romane, Novellen und Dramen hinzu.
Deutsch in der Sekundarstufe II
Für das Fach Deutsch sieht der relevante Lehrplan, das niedersächsische Kernkurriculum (KC), in den vier Halbjahren insgesamt sieben Rahmenthemen vor: zwei pro Halbjahr, eins im Prüfungshalbjahr. Ein Rahmenthema enthält immer ein Pflichtmodul, das für alle Oberstufenschüler in Niedersachsen verpflichtend ist. Zusätzlich muss im eA Kurs jeweils ein weiteres Wahlpflichtmodul behandelt werden. Im gA Kurs müssen in den vier Halbjahren drei weitere Wahlpflichtmodule behandelt werden. Dazu schlägt das KC pro Rahmenthema acht Module – insgesamt folglich 56 Module – vor, aus denen unter Berücksichtigung der vom Kultusministerium vorgegebenen Wahlpflichtmodule die Fachgruppe Deutsch auswählen kann. (s. Übersicht)
Der Unterricht im Kurs auf erhöhtem Niveau (P1-3) erfolgt fünfstündig. Es sind 5 Ganzschriften verbindlich zu lesen.
Der Unterricht im Kurs auf grundlegendem Niveau (P4, P5 und alle, die Deutsch nicht als Prüfungsfach gewählt haben) erfolgt dreistündig, es sind drei Ganzschriften verbindlich zu lesen.
Außerunterrichtliche Aktivitäten
Außerunterrichtliche Angebote variieren je nach Angebot und können der Besuch der Schulkinowochen, eine Lesenacht oder ein Theaterbesuch sein. Möglich sind auch der Besuch einer Buchhandlung, der Bibliothek oder einer Autorenlesung.
Leistungsbewertung im Fach Deutsch
In den Jahrgängen 5-9 werden in der Regel vier Klassenarbeiten (zwei pro Halbjahr) geschrieben, davon ist jeweils eine eine Rechtschreibüberprüfung mit Grammatikteil. In den Jahrgängen 10 und 11 wird das Fach Deutsch nur dreistündig unterrichtet, daher werden auch nur drei Arbeiten geschrieben. Klausuren in der Oberstufe folgen dem jeweiligen Oberstufenerlass.
Bei zwei Arbeiten pro Halbjahr liegt die Gewichtung von mündlicher und schriftlicher Leistung meist bei je etwa 50% und bei nur einer Arbeit bei etwa 40% schriftlicher Leistung und 60% mündlicher Mitarbeit. In diese mündliche Mitarbeit fließen die aktive Beteiligung am Unterricht, sorgfältig angefertigte Hausaufgaben, Ergebnisse von Partner – und Gruppenarbeiten und kleinerer Referate, Präsentationen, Lektüre-, Grammatik- und Rechtschreibtests mit ein.
In Aufsätzen wird nicht nur der Inhalt (= Verstehensleistung) benotet, sondern auch die Darstellungsleistung. Hierzu zählen z.B. Rechtschreib-, Zeichensetzungs- und Grammatikfehler, der sichere Umgang mit Fachsprache und funktionalem Zitieren oder auch die Einhaltung der äußeren Form.